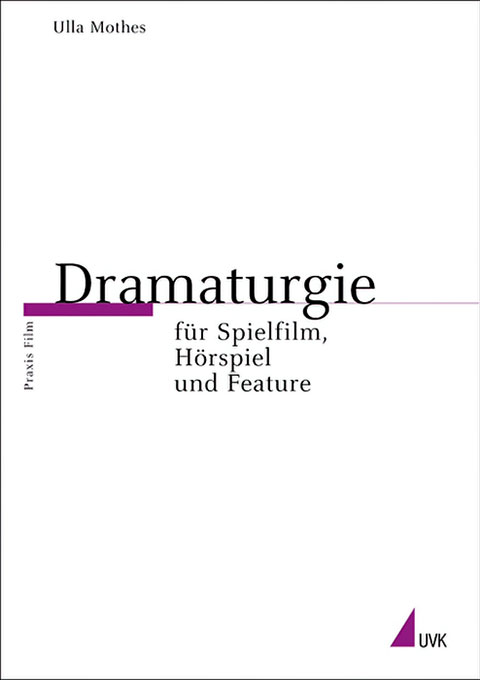LESEPROBE
Dramaturgie für Spielfilm, Hörspiel und Feature
Einführung
Was auffällt, ist relevant. Vermutlich gibt es mehrere Arten, einen Film zu betrachten, ein Hörspiel zu verfolgen oder die Überlegungen eines Features nachzuvollziehen. Und jeder Einzelne wird auf eine für ihn charakteristische Weise sich mit den erzählten oder vergegenwärtigten Geschichten auseinandersetzen. Sein Blick ist der des Rezipienten, desjenigen, der wahrnimmt und aufnimmt, desjenigen, der etwas mit der Geschichte anfängt. Das unterscheidet ihn deutlich von denjenigen, die die Geschichte entwickelt, ausformuliert und medientechnisch verarbeitet haben. Ihr Blick ist der dramaturgische, der gestaltende, der konzeptionelle. Mit ihm ist das, was den späteren Rezipienten berührt, ihn anspricht oder auch ungerührt lässt, vorgegeben. Es ist die Perspektive, um die sich dieses Buch bemüht. […]
5. Spannung
5.1 Neugier und Zweifel
„Es war ein alter Mann, der allein in einem kleinen Boot im Golfstrom fischte, und er war jetzt vierundachtzig Tage hintereinander hinausgefahren, ohne einen Fisch zu fangen.“ (Hemingway, 417)
Bereits im ersten Satz seiner Geschichte vom alten Mann und dem Meer erzeugt Ernest Hemingway die ganze Spannung des Folgegeschehens seiner Erzählung. Allein dieser Satz macht deutlich, dass nun dort draußen auf dem Meer etwas passieren wird, und zwar etwas Besonderes, etwas Einmaliges, etwas, das geeignet ist, eine Geschichte zu entwickeln. An die drei Monate hatte der Alte erfolglos gefischt. Dieses Mal, von dem die Geschichte erzählt, wird es anders sein.
Hemingway setzt mit diesem ersten Satz etwas Selbstverständliches voraus, nämlich die Erwartung seiner Leser, dass nur einer etwas erzählt, wenn er etwas zu erzählen hat. Erzählt wird das Besondere, das Auffällige, das, was nicht ohnehin erwartet wird, sondern im Gegenteil das, was nicht gewusst oder vorhergesehen wird. Wer erzählt, lässt etwas wissen. Und wer liest, sich einen Film ansieht oder ein Hörspiel oder Feature eingeschaltet hat, hat sich darauf eingelassen, etwas erfahren zu wollen. Zumindest, und diese Einschränkung betrifft moderne Fernseh- oder Radiohörgewohnheiten, ist er nicht abgeneigt, sich von etwas fesseln zu lassen. Hemingway geht mit seinem ersten Satz davon aus, dass seine Leser geneigt sind, Neugier zu entwickeln, und bietet ihnen einen konkreten Sachverhalt, auf den sie ihre Neugier richten können. Der erste Satz drückt eine defizitäre Situation aus. Ein Fischer fischt wochenlang nichts. Er entbehrt etwas, nämlich seinen beruflichen Erfolg, und, da er alt ist und trotzdem noch fischt, vermutlich auch die Grundlage seines Lebensunterhalts. Der erste Satz beschreibt einen in Schwierigkeiten geratenen Mann. Das ist noch nicht spannend, aber die Situation ist nicht zufriedenstellend, es ist ein Bedarf der Änderung angezeigt. Hemingway weckt die Neugier, wie dieser Mann mit seinen Schwierigkeiten umgehen oder fertig werden wird.
Es zeichnet diesen Einstieg aus, dass er mehr bewirkt, als zunächst einmal Neugier zu wecken. Wenn dieser Mann fast drei Monate nichts gefischt hat, täglich unverrichteter Dinge heimgekehrt ist, dann steht sein Ziel fest: Er will etwas fangen. Und der Erzähler, der an einem bestimmten Tag, nämlich dem fünfundachtzigsten, einhakt, setzt diesen Punkt ja nicht willkürlich. Es ist zu erwarten, dass der alte Mann an diesem Tag entweder etwas fangen wird oder etwas passiert, das ihn endgültig aufgeben lässt. Die sich darin ausdrückende Polarisierung bewirkt beim Leser einen Zweifel, ob der alte Mann sein Ziel erreichen wird oder nicht. Der Leser befindet sich im Ungewissen, eine für ihn unbefriedigende Situation, die ihn treibt, Gewissheit zu erlangen, also die Geschichte zu verfolgen. Er ist nicht mehr gleichgültig, sondern in Spannung versetzt. Somit lässt sich Spannung als ein aus der Geschichte an den Rezipienten weitergegebenes defizitäres Gefühl beschreiben.
Im Einstieg der meisten Filme, Hörspiele oder Features wird eine defizitäre Situation vorbereitet, indem aus einem ruhigen, zufriedenstellenden Zustand ein unruhiger oder bereits beunruhigender hergestellt wird. Dies geschieht durch eine Störung, einen Anstoß, der den Hauptkonflikt entstehen lässt, auf jeden Fall durch etwas, das kommende Schwierigkeiten ahnen lässt oder eine problematische Situation anzeigt. Die Neugier der Rezipienten, nämlich das Begehren, diese neue Situation sich bekannt zu machen, wird entfacht. Sie bindet die Aufmerksamkeit an das, was der Erzähler als relevant empfindet, und ist eine mögliche Voraussetzung für Spannung. Das Begehren, sich eine neue Situation bekannt zu machen, ist ein Gefühl, das kognitive Denkvorgänge auslöst. Sie erhalten Nahrung, wenn ein Erzähler seine mit der Problematik verbundene Idee, also das, was ihn bewegt, ausführt, indem er eine erste Absicht einer oder mehrerer Personen entwickelt. Diese Absicht trifft in einer Weise auf die beschriebene Schwierigkeit, die auf ihre Beseitigung hinzielt. Mit der Formulierung eines ersten konkreten Zieles wird die Neugier vom Gefühl des Zweifels abgelöst, ob dieses Ziel erreicht oder verfehlt wird, handlungsspezifisch ausgedrückt, ob eine Absicht verwirklicht oder vereitelt wird. In der Verfolgung von Absichten liegt die Möglichkeit zur Spannung. Spannung beginnt dann, wenn eine Absicht auf Schwierigkeiten stößt. Handlungsspezifisch ausgedrückt ist Spannung nichts weiter als der Zweifel, ob eine Absicht ihr Ziel erreicht, manchmal auch wie. Eugene Vale formuliert in „Die Technik des Drehbuchschreibens für Film und Fernsehen“ den Unterschied und das Verhältnis zwischen Neugier und Spannung so:
„Neugierde entsteht, wenn der Zuschauer nicht weiß, was die Filmfigur beabsichtigt, und Spannung, wen er nicht weiß, ob die Absicht verwirklicht oder vereitelt wird.“ (Vale, 175)
Bei einem Feature treten gewöhnlich unterschiedliche Ansichten und Meinungen zutage, aus denen ein Gesamtbild gewebt wird. Entsprechend einem Handlungsaufbau, in dem verschiedene Absichten aufeinandertreffen, werden in einem Feature thematische Probleme fortschreitend differenziert und unter verschiedenen Vorzeichen dargestellt. Jede einzelne Stellungnahme erfolgt aus einem anderen persönlichen Engagement heraus. Mit zunehmender Informationsdichte ändern sich die Antizipationen der Rezipienten im Hinblick auf das Bild, das sich am Ende ergeben wird, immer wieder. Das Thema erscheint in unterschiedlichem Licht. Das schafft eine komplizierte, kontrastierte Situation, von der die einzelnen Stimmen jedoch nicht wissen, denn die Mischung nimmt der Autor im Nachhinein vor. Es entsteht eine künstliche Situation, eine fiktive Dramatik, bei der Rezipienten schnell mehr wissen als die Beteiligten.
Durch die Montage im Hinblick auf die Rezeption ergibt sich also eine Auseinandersetzung mit dem Thema unter verschiedenen Kenntnisebenen. Am wenigsten wissen die auftretenden Personen, etwas mehr ein Rezipient, der sein Bild am jeweiligen Stand der Dinge entwickeln und überprüfen kann. Am meisten weiß der Autor, der sein Informationsziel am Ende der Sendung kennt und kognitive Denkprozesse bei Rezipienten in Gang setzt und durch seine Montage/ Montagetechnik, auch den Einsatz eines oder mehrerer Erzähler (Sprecher, Moderator), steuert. Rezipienten werden nicht vorhersehbaren, aber erahnbaren Ansichtswechseln ausgesetzt, sie antizipieren sie. Zugleich erwarten sie inhaltliche Bestätigung ihres Mehrwissens gegenüber auftretenden Personen im Hinblick auf deren Bestätigung oder Widerlegung. Der eigene Wissensvorsprung und die dadurch hervorgerufene Antizipation ist verbunden mit der Ungewissheit, welche Wendungen im Diskurs des Features eintreten.
Kern einer Erzählung ist etwas Besonderes, Auffälliges. In ihrem Einstieg machen Autoren darauf aufmerksam, indem sie ein mit dem Besonderen zu verknüpfendes Problem aufwerfen, eine defizitäre Situation schildern, eine Störung inszenieren oder eine Bedrohung eines als gewöhnlich oder harmonisch empfundenen Zustands nahelegen. Sie erwecken Neugier auf ein Geschehen. Sie sorgen dafür, dass die Neugier mit einem Zweifel verbunden wird, indem sie Rezipienten in Ungewissheit versetzen, was passieren wird. Ein Anliegen wird formuliert, das in Disharmonie oder Gegensatz zum Ausgangszustand steht und mit dem Aufwerfen des ersten Problems einhergeht. Die geschaffene Kausalität zwischen Neugier und Zweifel wird auch in der weiteren Komposition genutzt, indem eine Handlung oder Abhandlung Wendungen erfährt, die immer wieder Unklarheit darüber schaffen, wie etwas weitergeht oder gelöst wird. Damit wird das Bedürfnis von Rezipienten, Klarheit zu erlangen, angesprochen.
UVK, Konstanz 2001
© Ulla Mothes
Und je tiefer sie kam, desto gleißender wurde der Himmel, und das war noch nie so gewesen.
[ Seiltänzerin mittendrin ]
Kreatives Schreiben
Dramaturgie für Spielfilm, Hörspiel und Feature
Konstanz, 2001
UVK
ISBN: 3-89669-332-8
Was macht einen spannenden Spielfilm aus, und wie muss ein Feature oder Hörspiel konzipiert sein, um Zuschauer oder Hörer zu fesseln?
Die Grundfunktionen dramaturgisch-ästhetischer Gestaltung werden in diesem Buch erklärt und der Weg von der Idee bis zum fertigen Drehbuch eines Spielfilms sowie dem Skript eines Features oder Hörspiels beschrieben.
Die Beziehungen zwischen der Intention einer Erzählung, ihrer Handlung und den beabsichtigten Empfindungen der Zuschauer und Zuhörer werden aufgezeigt.
Um zu zeigen, wie auditives und audiovisuelles Erzählen funktioniert, werden zahlreiche Beispiele analysiert.
weitere Werke
Kreatives Schreiben: